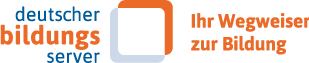Jumbojet der fliegenden Klassenzimmer

24.06.2004: Er stellt immerzu Fragen. Und er gibt nicht auf, bis er eine Antwort auf seine Frage erhalten hat. So löchert Maximilian, 8 Jahre, seine Eltern Tag für Tag. "Maximilian ist sehr wissbegierig", sagt der Vater. Doch dann erschallt eines Tages der Lockruf aus dem Radio: "Wie kommt das Meeresrauschen in die Muschel?" - eine Vorlesung für Kinder an der Universität Duisburg-Essen.
Der kleine Sokrates aus dem Ruhrpott ist reif für die Kinderuni. Dort hält Kommunikationswissenschaftler H. Walter Schmitz am 17. Juni 2004 eine Vorlesung über das Verhältnis zwischen Wahrnehmung und Kommunikation. Vater und Sohn wirken in der Masse ein wenig verloren, als sie das Foyer zum Hörsaal betreten.
"Ich will da mal reingehen"
Immer mehr Mädchen und Jungen im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren füllen den Eingang zum Audimax, den Hörsaal. Es ist laut wie auf einer Kinderparty. 700 Kinder erscheinen, überwiegend von ihren Müttern begleitet und vereinzelt von ihren Vätern. (In einem Jumbojet passen gerade mal 500 Passagiere.) Die Eltern dürfen nicht mit in den Hörsaal. In einem abgetrennten Saal verfolgen sie die Vorlesung auf einer Leinwand.
Schutzsuchend sitzt Maximilian dort zunächst auf dem Schoß des Vaters. Auf einmal geht ein Ruck durch ihn: "Ich will da mal reingehen", sagt der Sohn, der aufgeregt ist. Er versucht es zu verbergen. "Da" ist ein Hörsaal mit dem vielleicht neugierigsten Publikum. Ein Publikum, das keine Fehler in der Dramaturgie des Vortrags verzeiht. "Da" ist der Jumbo-Jet unter den fliegenden Klassenzimmern.
Während andere Kinderuni-Dozenten in Vorlesungen Themen aufgreifen, die auch schon auf den ersten Blick spannend sind, wie "Abenteuer Informatik - Roboter im Labyrinth" oder "Ein Blick ins Universum", versucht es Schmitz mit einem Thema, das nicht so positiv besetzt ist: wie Menschen mit Behinderungen sich verständigen können. Oder in der Fachsprache: "Sonderkommunikationsformen als gleichwertige, selbstständige Kommunikationsformen".
Doch der Professor spricht mit den Kindern nicht vom erhobenen Ross der abstrakten Wissenschaftssprache. Damit würde er in der Kinderarena gnadenlos untergehen. In den vorderen Reihen sitzen Schülerinnen und Schüler der Rheinischen Schule für Hörgeschädigte. Sie machen weniger Lärm. Hörgeräte klemmen hinter der Ohrmuschel einiger Junghörer.
Selbstests
Mit einem Rätsel eröffnet der Kommunikationswissenschaftler den Vortrag, mit dem "Kistenproblem". "Ich weiß, was in dieser Kiste drin ist, aber wie kann ich es schaffen, dass ihr wisst, was in der Kiste ist?" Eine Gebärdendolmetscherin zaubert die Worte des Professors mit ihren Händen in die Luft, so dass auch die hörgeschädigten Kinder alles mitbekommen. Zu sehen ist ein großer Bastkorb. Darin lauern unbekannte Gegenstände. Der Lehrer weiß, was drin ist, die Kinder nicht. Nun müssen sie Fragen stellen, um des Rätsels Lösung zu erhalten. Das Kommunikationsspiel beginnt.
Den Kleinen wird bewusst, dass die Sprache die Entfernung zum Professor überbrückt. Und dass die von der Stimme produzierten Schallwellen an ihre Ohrmuscheln branden müssen, damit sie von anderen wahrgenommen werden. Dass sie klar und deutlich sprechen müssen, damit es weniger Missverständnisse gibt. Die gesprochene Sprache ist also ein Königsweg, das Kistenproblem zu lösen - doch es gibt auch weniger ausgetretene Pfade.
Selbsttests sind ein probates Mittel, die Aufmerksamkeit der Kinder zu fesseln. "Aktivierung" nennen das die Experten. Wie fühlt sich Sprache eigentlich an? Hierzu sollen die Kinder ihre Hände an den Kehlkopf halten. Ein ganzer Hörsaal fasst sich an die Gurgel. Dabei spüren alle, was geschieht, wenn man sie ein stimmhaftes "S" anstimmt, wie bei "Summen". Und ein stimmloses "S" wie "Psst" sprechen. Ergebnis: der Kehlkopf vibriert nur beim stimmhaften "S". "Da hat man gehört, wie der Kopf brummt", antwortet ein Kind auf die Frage nach dem Unterschied. Weil das so ist mit dem Sprechen, hören wir uns selbst anders als das Gegenüber. Also: um sprechen zu können, muss man "sich selbst live hören können".
Immerhin 47.000 gehörlose Menschen in Deutschland können genau dies nicht. Auch die 208.000 Schwerhörigen haben dabei Schwierigkeiten. Immer wieder streut Schmitz Zwischenergebnisse ein, die starke Gliederung des Vortrages macht das Wissen für die Kinder fassbarer.
Einblick in das Universum der Zeichensprache
Aus diesem Grund ist eine "sichtbare Sprache, die man nicht zu hören braucht" ein wichtiges Instrument, um sich mit anderen Menschen verständigen zu können. So wie die Deutsche Gebärdensprache (DGS). Der Kommunikationsforscher hält sie für eine "vollwertige Sprache mit eigener Grammatik". Mit eigenen Dialekten. So drücke sich ein Rheinländer in Gebärdensprache anders aus, als ein Bayer, meint Schmitz. Nach 30 Minuten lässt die Aufmerksamkeit merklich nach: Immer mehr Kinder stehen auf oder spielen mit ihren Schlüsselanhängern. Sie trommeln mit den Stiften auf die Pulte und quatschen mit dem Nachbarn. Andere hören zwar immer noch zu. Doch insgesamt wird es zusehends lauter.
Aber die Dramaturgie des Kommunikationsexperten stimmt: Ein Film aus den 60er Jahren über Helen Keller, die 1880 in Alabama geboren wurde, überzieht den Hörsaal mit wundersamer Stille. Helen wurde gesund geboren, doch mit 19 Monaten bekam sie ein schweres Fieber. Danach konnte sie weder hören, noch sehen. Nur eines hat sie gelernt: "wawa", das kindliche Wort für "water", also Wasser auf Deutsch. Außerdem hatte sie eine Geste gelernt, mit der sie ihre Mutter rufen konnte. Ein Wort, eine Geste - ein spärlicher Anfang für eine umfassende Verständigung mit der Welt.
Erst der Erzieherin Anne Sullivan gelingt es, sich sprachlich mit Helen zu verständigen. Sie bringt ihr geduldig das Fingeralphabet bei. Helen tastet die Hand ihrer Erzieherin ab, die sich zu einem Buchstaben des Fingeralphabets formt. Sie formt Buchstaben wie Skulpturen. Helen war zu Beginn dieses Kontaktes ruppig, ja aggressiv. "Sie war schlecht erzogen, weil sie keine Sprache hatte" - so Schmitz. Erziehung setzt also voraus, dass man sich überhaupt mitteilen kann und nicht sprachlos ist.
Allmählich lernt Helen mit Hilfe des Fingeralphabets "Puppe" zu buchstabieren und öffnet sich so die Welt der Verständigung mit den anderen Menschen. Sie lernt auf diese Weise auch "water" zu buchstabieren und zapft somit den unversiegbaren Quell der Sprache an. Faszinierend! Als die Filmsequenz endet, stöhnen die Kinder enttäuscht: "Ohh".
Produktive Verunsicherung
Eine kurze Rückblende: Wie fühlt man sich vor einer Vorlesung in der Kinderuni, wenn der ganze Saal dröhnt? "Da ist durchaus so etwas wie eine Verunsicherung" zu spüren, sagt Schmitz. Es ist seine erste Vorlesung für Kinder. Er sieht die Vorlesung als eine "Art von Selbstprüfung. Um nicht unterzugehen, versucht er sich an das Vorwissen der Kinder anzupassen. Zu diesem Zweck hat er sich eigens im Museum für Kommunikationsgeschichte in Hamburg umgeschaut. Was bei Studierenden als selbstverständlich und als Grundlage für Vorlesungen vorausgesetzt wird - hier müsse es infragegestellt werden.
Und nach der Vorlesung: "Es war anders, als ich es mir vorgestellt habe." Es herrschte ein "störender, beständiger Geräuschpegel". Kinderuni ist für Schmitz weniger eine Frage der Didaktik, als eine "Frage der Toleranz": "Wie viel an Lebhaftigkeit und Tönen lässt man einfach geschehen?" Vielen Lehrenden, die sonst mit Erwachsenen zu tun hätten, fehle einfach die Geduld.
Sabine Zix, Pressestelle Uni Duisburg-Essen, ist überzeugt, dass die Kindervorlesungen die Lehrenden anregen, "über ihr Lehrangebot nachzudenken". Sie sieht positive Wirkungen bei den nachfolgenden Generationen. Befragungen an der Uni hätten ergeben, dass fast ein Drittel der Kinder aus bildungsfernen Schichten kommen. Die frühe Integration der Kinder aus dem Ruhrgebiet in den Wissenschaftsbetrieb unterstütze daher den Strukturwandel in Essen.
Entzaubert
Eine Frage steht noch aus: wie kommt das Meeresrauschen in die Muschel? Einige Kinder bekommen vier große Muscheln und Gläser und halten sie an die Ohren. Eins hört ein Rauschen und meint, das Meeresrauschen sei in der Muschel hängegeblieben, weil diese Jahre im Meer verbracht habe. Ein anderes nimmt "einen Tornado" wahr, wieder ein anderes hört "Wellen".
Aber warum hört man dann auch ein Rauschen, wenn man ein Glas ans Ohr hält? "Ich glaube, das hängt gar nicht damit zusammen, dass die Muschel solange im Meer gelegen hat", sagt ein Kind, das sich der Antwort nähert. Wer in die Muschel hört, der hört sich selbst, sein Blut: Wir hören uns also selbst. Entzaubert ist das Rauschen der Muschel.
Am Ende findet Saskia, 8 Jahre, sie sei "ein bisschen schlauer geworden". Es sei anders als in der Schule, weil man keine Hausaufgaben kriege und weil der Professor alles besser erkläre. Maximilian glaubt, alles verstanden zu haben. Doch spätestens auf dem Weg nach Hause tauchen bestimmt neue Fragen auf.
Autor(in): Arnd Zickgraf
Kontakt zur Redaktion
Datum: 24.06.2004
© Bildung + Innovation
Ihr Kommentar zu diesem Beitrag. Dieser Beitrag wurde bisher nicht kommentiert.
Die Übernahme von Artikeln und Interviews - auch auszugsweise und/oder bei Nennung der Quelle - ist nur nach Zustimmung der Online-Redaktion von Bildung + Innovation erlaubt.